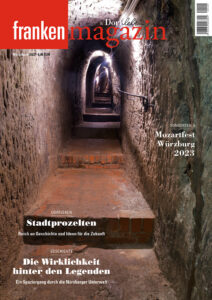Verdächtig rund
Der Star-Reporter Claas Relotius stürzt den deutschen Journalismus in seine schlimmste Glaubwürdigkeitskrise. Wie aber lassen sich Literatur und Journalismus, bzw. im Journalismus Erdichtetes und Wahrhaftes unterscheiden?
Text: Wolf-Dietrich Weissbach
Jetzt, wo wir es unbedingt einmal einlösen wollten, erweist sich Nina Ruges Versprechen doch als Fake. Es wird nichts, gar nichts wird gut. Es wird ziemlich sicher keinen geläuterten Post-Relotius-Journalismus geben. Vermutlich nicht einmal beim „Spiegel“, dessen Star-Reporter Claas-Hendrik Relotius über Jahre seine Artikel gefälscht hat, der hinzugedichtet hat, Protagonisten erfunden, Geschehen verzerrt, betrogen und gelogen hat, und der für seine Werke (um nicht zynisch „dafür“ zu sagen) in den letzten Jahren mit vielen bedeutenden Journalistenpreisen ausgezeichnet worden ist. Egal sollte uns das nicht sein: Die Geschichte geht uns alle an. Wir brauchen einen funktionierenden, einen wahrhaftigen Journalismus und das gilt es auch den großen Presseverlagen klarzumachen. Wenn die Medien nur auf Rendite schauen und uns egal ist, ob sie sich wenigstens um Glaubwürdigkeit bemühen, gefährden wir in unserer komplizierten Welt nicht nur unsere Demokratie, sondern genaugenommen auch unser Leben, so pathetisch sich das anhören mag. Im Moment gewinnt man freilich den Eindruck, daß der Fall Relotius in der breiten Öffentlichkeit schon niemand mehr groß interessiert. Dem wollen wir etwas entgegensetzen und dabei geht es nicht nur darum, daß uns ein verantwortungsloser Journalist, und das ist er, belogen hat. Nicht die einzelne Lüge ist dabei das Wichtige. Wichtig ist die Haltung des Journalisten wie des Verlegers, wenn man so will: die Moral der Medien. Kein einfaches Thema, ein Thema mit vielen Fallstricken. Hier soll versucht werden, wenigstens ein Gespür dafür zu erzeugen.
Wie auch immer, im Schmerz über den Fall Relotius sind sich die Lichtgestalten der Branche einig: Der Schaden für die Glaubwürdigkeit der Medien – vor allem der anspruchsvollen Printmedien – ist gar nicht zu ermessen; sie ist ersteinmal dahin. Wie und ob sich dies für den Journalismus überhaupt auswirkt, wird sich wohl noch weisen. Dabei: Laut Andreas Wolfers von der Henri-Nannen-Journalistenschule wären viele der Fälschungen des Reporter-Stars gar nicht nötig gewesen; die Geschichten hätten „auch ohne Blendwerk gute Texte werden können.“ (Andreas Wolfers, „Die Zeit“ am 31.Januar 2019) Insgeheim vertraut man in der Branche vermutlich einmal mehr auf den Lauf der Zeit. Unehrlichen Journalismus hat es schließlich schon früher gegeben und es hat der Bild-Zeitung nie geschadet. Augensperrig erinnert sei an die Hitler-Tagebücher („stern“ 1983) oder die erfundenen Interviews mit Hollywoodstars eines Tom Kummer (u. a. SZ-Magazin 2000), die beinahe noch als „Borderline-Journalismus“ geadelt worden wären; auch in den USA gab es spektakuläre Fälle etwa um Stephen Glass (1998), der für das damals neokonservative, seit 2016 linksliberale, einflußreiche Politmagazin „The New Republic“ siebenundzwanzig gefälschte Artikel verfaßt hatte, darunter die Geschichte über einen infantilen, geldgierigen Hacker, der gleich zur Gänze erfunden war; oder Jayson Blair, Journalist der New York Times, der 2003 aufgrund von Plagiaten und Erfindungen aufflog. Blair presste seine Geschichte, die gewisse Ähnlichkeiten zu der von Relotius aufweisen soll, übrigens gleich noch in ein Hardcover (Burning Down My Master‘s House: My Life at the New York Times. 2004), das demnächst in Deutsch erscheinen könnte, kommt Relotius dem nicht zuvor – er hat nämlich mehr zu bieten.
„Wir haben verstanden“
Vielleicht ist die Gesamtsituation diesmal aber doch etwas anders. Wenn es nicht gar ein böses Omen ist, daß das Hamburger Nachrichtenmagazin, das sich selbst als Avantgarde des Journalismus begreift, ausgerechnet in dem Moment vom größten Skandal seiner siebzigjährigen Geschichte erschüttert wird, in dem mit der Zusammenlegung von Print- und Online-Redaktion der Qualitätsjournalismus (amerik. „legacy media“) ins digitale Zeitalter gestreamt werden soll. Die neue Chefredaktion um Steffen Klusmann, Barbara Hans und dem Förderer des Reportertalentes Relotius, Ullrich Fichtner, der allerdings noch im Februar nicht im Impressum auftaucht, dürfte die nächste Zeit vor allem mit der Aufarbeitung der Wahrhaftigkeitskrise des Hauses beschäftigt sein. Das geschieht, dem Vernehmen nach, gründlich und vorbildlich. Daß Klusmann dies mit einem Werbeslogan des Autobauers Opel aus den 90er Jahren: „Wir haben verstanden.“ bekräftigt, ist möglicherweise der Erregung geschuldet – wie wohl auch die etwas fragwürdige Formulierung, es gälte die „journalistische Schlagkraft“ des Hauses wiederherzustellen. Jedenfalls wird man auf die Ergebnisse der Aufarbeitung in Sachen Relotius etwas warten müssen. Für die Auguren der Presse-Imperien Gelegenheit zur Besinnung: Was war die Aufgabe des Journalismus in unserer Gesellschaft doch gleich wieder? In den Kommentaren zur Causa Relotius wird dieses Thema kaum berührt. Eine Ausnahme macht ausgerechnet Springer-Chef Mathias Döpfner (NZZ, am 9.2.2019), der in dem Fall die systemischen Probleme großer Teile der Branche sieht. Nach seiner Ansicht wird geschrieben, was gewünscht wird. Hinzu kommt: „Viele Journalisten schreiben für die Kollegen statt für die Leser.“ Fehlentwicklungen, beispielsweise selbst die vermutlich unbeabsichtigte Unterstützung der AfD, sind für Döpfner nicht von der Hand zu weisen. Daß die Orientierung am immersiven Journalismus bestimmter Internetformate oder überhaupt am amerikanischen Magazinjournalismus, was vor allem das „storytelling“ betrifft, ausschmückende Übertreibungen und zentralperspektivische Simplifizierungen beispielsweise regelrecht begünstigt, sollte in der Branche selbstkritisch gesehen werden. Halten wir nur fest, daß laut Döpfner gegenwärtig die Springer-Presse zum Hort des wahren Journalismus geworden ist.
Man hätte es merken müssen
Für die journalistischen Leuchttürme betont Holger Stark in der „Zeit“ und das nur ganz allgemein die Wächterfunktion und damit die besondere Verantwortung der Journalisten. „Journalisten haben in einer Demokratie die Funktion der Kontrolle der Mächtigen. Wer andere kritisiert, der steht selbst unter Beobachtung, und daran ist nichts Falsches.“ („DIE ZEIT“ vom 27.12.2018) Das findet auch der langjährige „Spiegel“-Redakteur Cordt Schnibben: „Ich habe ganz schlecht geschlafen …, weil wir in diesen Zeiten sowieso große Probleme haben, glaubwürdig rüberzukommen. Einerseits durch ideologische Vorhaltungen, andererseits können die Leute unsere Arbeit durch das Internet viel stärker kontrollieren, kritisieren und auch verbessern – was ja gut ist.“ (FAZ vom 21.12.2018) Man muß sich den Sand aus den Augen reiben: Aber weder der eine noch der andere will an den Kern. Sie betrachten sich einfach als Vertreter eines guten, schon von den Altvorderen „ererbten“ Jounalismus, ohne die angesichts dieser Glaubwürdigkeitskrise eigentlich naheliegende Frage, was Journalismus (auch in Form der Reportage) für den Bürger/Leser heute eigentlich leisten muß, auch nur anklingen zu lassen; ob und wie die Rolle des Wächters eingenommen werden kann.
Selbst die vermutlich noch in Stahl geschnitzte Reporter-Matrize, Hans Leyendecker, einer der profiliertesten investigativen Journalisten Deutschlands, vertraut auf die „heute sehr ausgereifte Gegenrecherche“, sieht im Fall Relotius „kein systemisches Problem“ und fokussiert wie die meisten seiner prominenten Kollegen auf die Form, die Sprache. (Journalist 1+2/2019) Die Geschichten von Claas Relotius, darin sind sich Cordt Schnibben und Hans Leyendecker auch mit dem „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo einig, „waren von einer Glätte, einer Perfektion und Detailbesessenheit“ („Spiegel“-Interview am 21.12.2018), sie waren einfach zu schön, um wahr zu sein.
Die SZ-Autorinnen* David Denk und Angelika Slavik (SZ 20.12.2018) freilich waren von den Geschichten des Ausnahmetalentes begeistert. Ebenso wie die Jury zum Deutschen Reporterpreis, den Relotius wenige Tage vor seinem Absturz zum vierten Mal zugesprochen bekommen hatte. Sie würdigte einen Text als „von beipielloser Leichtigkeit, Dichte und Relevanz, der nie offenläßt, auf welchen Quellen er basiert“. Die Jury (wie andere vor ihr) hat also nicht gemerkt, was man laut Di Lorenzo, Leyendecker, Schnibben hätte merken können, wenn nicht gar „müssen“. Die Granden jedenfalls, das geben sie deutlich zu verstehen, hatten es geahnt – entlarvt wurde Relotius allerdings von Juan Moreno, der schlicht nachrecherchiert hatte. Die pure Einsicht in die „Komplexität des Lebens“, daß „das Leben voller Widersprüche, Unebenheiten und Schlaglöcher“ ist, Journalismus „nur eine Annäherung daran, guter Journalismus eine möglichst präzise Annäherung“ ist (Holger Stark), und deshalb Geschichten, die „zu rund“ sind, einfach verdächtig sein müßten, reicht augenscheinlich als Wahrheitskriterium nicht aus. Interessant wäre zu erfahren, wie wenig „rund“ nun eine Geschichte sein darf, um unverdächtig zu sein und vor allem bevor sie einfach nur „schlecht“ ist. Ohne den Größen des deutschen Journalismus absprechen zu wollen, daß sie eine „gute Geschichte“ erkennen (sie wären nicht geworden, was sie sind), wird hier doch bezweifelt, daß allein an der Form, an der Sprache auszumachen ist, ob es sich um eine wahre oder eine gelogene, verfälschte Story handelt.
Trennung von Literatur und Journalismus
Genau dieses Problem wird, entlang der gesamten Geschichte des Journalismus, ja tatsächlich: gewälzt! Vielsagend beginnt diese Geschichte mit einer zwielichtigen, allerdings irgendwie sympathischen oder wenigstens amüsanten Gestalt: Pietro Aretino (1492–1556), nach allgemeiner Ansicht der erste, bisweilen wohl auch käufliche Journalist (Boulevard) der Moderne. Aretino hat allerdings noch keine Reportage geschrieben. Die Reportage (von lat. reportare = zurückbringen, mit nach Hause bringen, melden, berichten) ist eine verhältnismäßig neue literarische Gattung, die als Kommunikationsform auf das althergebrachte Genre des Erzählens und auf die Kultur des Zuhörens und insofern auf Reiseberichte und Augenzeugenberichte zurückgeht. Von Herodot (um 450 v.Chr.) über die Berichte der spanischen und portugiesischen Seefahrer über ihre Raub- und Vernichtungsfeldzüge, zu den Abenteuerromanen (Grimmelshausen) hin zu den Reisetagebüchern (Goethe) kommt es erst mit Novalis („Heinrich von Ofterdingen“ 1802) zur strikten Trennung von Literatur und Journalismus. „Die Literatur reklamierte für sich die wahre Wirklichkeit gestalteter Sprache, die, von den Fesseln des Realismus befreit, das Wesen des Menschseins viel tiefgründiger zum Ausdruck bringen könne.“ (Michael Haller, Die Reportage. 1987) Zeitgleich eröffnete der als Bauernsohn und Söldner durch eine harte Schule des Lebens gegangene, deutsche Schriftsteller Johann Gottfried Seume durch sein „Plädoyer für die handwerklich seriöse Arbeitsweise des Reporters, der präzis zu beobachten und seine Beobachtungen auch zu belegen, mithin zu recherchieren habe“ (ebd.) im Vorwort zu seinem Reisetagebuch „Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802“ den für die deutsche Literatur seither kennzeichnenden Realismus-Streit. Seumes aufs Handwerkliche des seriösen Journalisten zielende Forderungen: Dokumentation (Recherche), Authentizität, Glaubwürdigkeit (= Überprüfbarkeit des Faktischen), Unmittelbarkeit und Redlichkeit (= Thema wichtiger nehmen als sich selbst) haben nach Haller bis heute Gültigkeit.
Literaturfähig
Besonders intensiv wurde die besagte Realismus-Debatte freilich erst in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geführt, angeregt durch die Reportagen des „rasenden Reporters“ Egon Erwin Kisch. Wobei nicht verschwiegen werden sollte, daß Kisch einige, nach heutigen Gesichtspunkten womöglich gar seriösere Vorgängerinnen* hatte. Etwa die Amerikanerin Nellie Bly, die sich 1887 dreiundzwanzigjährig für die Zeitschrift „New York World“ zehn Tage in die New-Yorker psychiatrische Frauenanstalt Blackwell Island einweisen ließ, um über die dortigen Zustände berichten zu können. Sie gehörte zu den sogenannten „Stunt-Girls“ und wurde für ihren investigativen Journalismus berühmt. Auch der Schöpfer der Sozialreportage im deutschsprachigen Raum, der in den 1980er Jahren wiederentdeckte „Wallraff der Monarchie“, der 1937 völlig verarmt im Exil in Hollywood verstorbene, österreichische Journalist Max Winter, der in den 30ern vom Leben der Wiener Obdachlosen (Max Winter: „Die Steigeisen der Kopflaus“, Wien 2012) berichtet hatte, ist zu nennen. Ebenso die „Stenographin des Verbrechens“, die bekannteste Gerichtsreporterin der zwanziger Jahre, Gabriele Tergit, die die Alltagssorgen des kleinen Mannes und die Schicksale der Frauen in den gewalttätigen Verhältnissen des damaligen Berlins aufzeigen wollte.
Zweifellos war aber Kisch der bekannteste Journalist in der Welt vor dem Zweiten Weltkrieg. Kisch berichtete über Kriminalfälle, „recherchierte verdeckt“ und engagierte sich politisch, in Österreich, Europa und selbst in Australien. Er plädierte für die „neue Sachlichkeit“ nach dem Vorbild der französischen Literaten Balzac und Zola und forderte von der journalistischen Reportage, sie solle dem Realismus verpflichtet und von literarischer Qualität sein. Und während etwa Georg Lukàcs, Siegfried Krakauer und Walter Benjamin die (journalistische) Reportage nur als oberflächlich, auf bloße Erscheinungen festgelegten Bericht gelten ließen, der „schnell erstellt und flüchtig konsumiert“ werde – was gegenwärtig wieder von verschiedenen Seiten gegen die Reportage vorgebracht wird –, wurde sie doch in Frankreich und Deutschland als Kunstform, als literaturfähig, anerkannt. Nach Kisch habe der Reporter ein „Schriftsteller der Wahrheit“ zu sein. „Ein Chronist, der lügt, ist erledigt.“ So Kisch! Selbst hat er sich allerdings nicht immer an seine Maßgaben gehalten bzw. hat diese auch mehrfach geändert.
Während er im Vorwort seines Reportagebandes „Der rasende Reporter“ geschrieben hatte: „Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit“ stellt er zehn Jahre später, 1935, auf dem Pariser Kongress „Zur Verteidigung der Kultur“ in seiner Rede die „Reportage als Kunstform und Kampfform“ vor. Die Reportage habe – so Kisch, schon „physiologisch linksstehend“ (Ausdruck stammt von Kischs Zeitgenossen Anton Ku) – nicht nur eine „sozialkritische Funktion, sondern sie solle derart gestaltet sein, daß sie zur Kampfform der Literatur wird“. Sie soll als eine politisch engagierte Literaturform verstanden werden. (siehe: Daniela Ihl, Egon Erwin Kischs Reportagebuch: Landung in Australien. Ffm. 2010)
Kisch fordert, was man heute wohl als intentionalen Journalismus bezeichnen müßte. Was allerdings auch den Nazis taugte. „Die Reportage war, soweit überhaupt erwünscht, gerade gut genug, die Polit-Kampagnen von Partei und NS-Staat mit sinnlichem Material anschaulich und gefühlvoll zu machen.“ (Haller)
Comeback der Reportage
Ende der 40er Jahre beim Wiederaufbau der deutschen Presse war deshalb zunächst der „faktengläubige, positivistische Nachrichtenjournalismus der angelsächsischen Länder“ angesagt, der allerdings, wie man bereits in den 1960er Jahren feststellte, durchaus auch die Realität verzerren konnte. Bis in die 80er Jahre galt dennoch „die klare Trennung zwischen Nachricht und Meinung. Denn mit Hilfe bewußter Verwischung der Grenze zwischen beiden hatte der Nationalsozialismus die Öffentlichkeit irregeführt.“ (FAZ vom 7.5.1960 / laut Haller) Subjektive Elemente, Reportage, Erzählung, Feature, Essay fanden in der bundesdeutschen Presse praktisch nicht mehr statt. „Es scheint, als gehöre die Form der literarischen Reportage der Vergangenheit an“, schrieb Kisch-Herausgeber Erhard Schütz noch 1978. Schütz war es freilich auch, der Egon Erwin Kisch der versierten Verbindung von Fakten und Fiktion („Faction“) zieh. „Es genüge nicht mehr, so Kisch in Paris, die Realität, das grauenhafte Modell, nur in allen Einzelheiten abzubilden, die Realität solle vielmehr >anklägerisch< dargestellt werden, wozu zusätzlich künstlerische Mittel zu mobilisieren sind“, faßt Daniela Ihl die Position Kischs zusammen. Wahrheit war wohl aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse für Kisch etwas anderes geworden als in seinen Zeiten als rasender Reporter. Kisch hat sich aus politischer Überzeugung von der Wahrheit entfernt, wohl nicht aus egoistischen Gründen. Man würde und sollte das im heutigen Journalismus nicht akzeptieren. Gleichwohl hat er zeitlebens um den „wahren Journalismus“ gerungen. Uns heutigen Journalisten und Lesern sollten die Augen tränen angesichts einer Geschichte des Journalismus, in der sich unzählige aufrichtige, mutige Männer und Frauen darum bemüht haben, aus der Welt ein Bessere zu machen. Und das reicht natürlich bis in unsere Tage.
Mit der Gründung der Reportagenzeitschrift „Geo“ (1976) erlebte auch die Zeitschriftenreportage ihr Comeback. Allerdings nicht als „Kampfform“. „Ein >Stück Natur, betrachtet durch ein Temperament< ist nach Zola ein Stück Kunstwerk. Doch kann auch eine Reportage dabei herauskommen“, konnte man im „Spiegel“ lesen. Zwar war der Verweis auf Zola aufgrund eines völlig anderen Kunstverständnisses zu vergangenen Tagen, schon in den 80ern irreführend, aber wie immer man im Vergleich zu Kischs Vorstellungen Themen und Aufgaben der modernen Reportage bestimmt, bis zum heutigen Tage ist die Abgrenzung der Reportage von Literatur und Journalismus eigentlich ungeklärt. Das mag am New Journalism der Sechziger und Siebzigerjahre gelegen haben, als Schriftsteller wie Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer oder die First Lady der Kriegsreportage, Martha Gellhorn, literarische Erzähltechniken (wieder) in den Journalismus einführten. Jedenfalls wird vor dem Hintergrund der Affaire Relotius erneut heftig darüber gestritten.
Journalistisches Realitätsprinzip
Während aber Andreas Wolfers (Henri-Nannen-Journalistenschule) grundsätzlich jegliche Erfindung in einer Reportage ablehnt, gleichwohl das Schönschreiben liebt und als vertrauensbildende Maßnahme zusätzlich beigestellte Paratexte fordert, in denen der Autor die Authentizität seiner Geschichte belegen sollte, wird in älteren Journalistenhandbüchern ein „journalistisches Realitätsprinzip“ ausdrücklich zugelassen. Das besagt, daß die zur Zeit anzutreffenden Verhältnisse gestalterisch ausgeschöpft, aber nicht entstellt werden dürfen. Der namenlose Amerikaner auf Joseph Roths Wolgafahrt hätte ja tatsächlich an Bord sein können – vielleicht nur an einem anderen Tag. Genau dieses Realitätsprinzip bringt Angelika Overath, Dozentin an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern, zugunsten der einstigen „Spiegel“-Redakteurin Marie-Luise Scherer in Stellung. (Sagen, was Stil ist. FAZ vom 28.12.2018) Scherer hatte ihre Reportage über einen Serienmörder in Paris (1990) mit den geradezu atemberaubenden Sätzen begonnen. „Mademoiselle Iona Seigaresco hatte es eilig, eine alte Frau zu werden. Sie trug einen kleinen, braunen Filzhut, den sie sich ohne das Echo ihres Garderobenspiegels zu beachten, einfach überstülpte. Nur fest und tief mußte er sitzen und das Gesicht wegnehmen. Die Handtasche hing ihr an einem knappen Riemen vor der Brust. Sie ging stark gebeugt, was ihr jedoch nicht ersparte, die Obszönitäten am Boulevard de Clichy zu sehen, an dem sie wohnte.“
Davon abgesehen, daß diese Sätze beinahe schon alleine ein Autorinnenleben rechtfertigten, unmittelbar erlebt, gesehen hatte Marie-Luise Scherer dies gewiß nicht. Sie hat es erfunden, weil es so gewesen sein konnte. Gleichwohl handelt es sich bei diesem Text für Angelika Overath um eine (journalistische) Reportage, als „eine literarische Form“. In ihr „wird Wirklichkeit durch das Temperament eines Autors gesehen. Sie ist im besten Fall subjektiv und objektiv zugleich“. Daß Overath Scherers Text gegen Relotius, also etwa gegen seinen mehrfach preisgekrönten „Märchentext“ „Königskinder“ aufrechnet, in dem es um Kriegswaisen aus Aleppo geht, ist unbarmherzig entlarvend … allerdings nicht sonderlich beweiskräftig. Sie erkennt die sprachlichen und stilistischen Schwächen. Nur: Wer sonst, wenn er bzw. sie nicht mit der Nase darauf gestupst wird? Zweifellos aber verdeutlicht Overath, daß es – ohne dies im Einzelnen auszuführen – auf die (moralische) Haltung, das Anliegen des Autors und auf den Verwertungszusammenhang ankommt. Es versteht sich von selbst, daß es ein Unterschied ist, ob ein Autor eine Botschaft hat oder nur beschreiben will, was er sieht, ob er religiös, politisch, sozial, altruistisch motiviert ist oder nur egoistische Interessen verfolgt; es versteht sich von selbst, daß es einen Unterschied macht, ob ein Text aktuell, „in der Zeit“, in einer Zeitschrift oder, „zeitlos“, in einem Sammelband (Best of!) erscheint. Strenggenommen lassen sich all diese Aspekte aber nicht objektivieren, von Banalitäten abgesehen, jedenfalls nicht anhand Sprache und Stil.
Gedankenspiel
Man kann mit einem freilich hinkenden Vergleich ein Gedankenspiel eröffnen. Ein literarisches Kunstwerk wäre danach die Objektivation einer schriftstellerischen Idee, hätte einen ersten und einen letzten Satz, wäre wie ein Gemälde eine von einem Rand, Rahmen, Grenze umfaßte, eigene Welt. Diese Welt bestünde nur und ausschließlich aus den dargestellten Elementen – die Diegese –, die sich alle stimmig aufeinander beziehen; das Gemälde ist somit prinzipiell interpretierbar. Das literarische Kunstwerk mag symbolisch für etwas anderes stehen, dennoch weist nichts aus dem Kunstwerk notwendig, zwingend hinaus auf eine es umgebende Welt.
In diesem Gedankenspiel entspräche zum anderen die journalistische Reportage einer Fotografie. Keiner gewöhnlichen: Bezugnehmend auf Siegfried Krakauer, wonach die Reportage der Versuch sei, mit einem durchlöcherten Eimer aus dem Leben zu schöpfen, handelte es sich stets um eine Fotografie mit Flecken, zunächst irgendwie undefinierbaren Flecken. Für den Leser ergibt sich somit die Schwierigkeit, einerseits diese Leerstellen gedanklich auszufüllen, andererseits, insofern sich die Fotografie als Ausschnitt aus der Wirklichkeit versteht, die Fotografie in alle Richtungen, nach allen nur denkbaren Seiten weiter zu denken. Das könnte das sein, was Gustav Seibt (SZ vom 11.1.2019) als „Geistesbeschäftigung mit dem Tatsächlichen“ bezeichnet. In einer etwas banaleren Vorstellung verwiese dies vielleicht auf eine Welt wie sie Steven Spielberg in dem Film „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ geschaffen hat, in der reale Welt und Zeichentrick miteinander verschmolzen sind. Um im Gedankenspiel zu bleiben: Alle Leerstellen der Fotografie bzw. der Reportage wie auch die mehrdimensionalen Verlängerungen über den Rand der Fotografie bzw. der Reportage hinaus (bis direkt vor die Füße des Lesers) werden vom Leser entsprechend seinem (begrenzten) Wissen, seiner (mehr oder weniger eingeschränkten) Vorstellungskraft virtuell in die realistische Darstellung nachbelichtet, ausgemalt. Insofern kann die Reportage tatsächlich kein rundes, in sich stimmiges Ganzes ergeben. Der Haken ist, als Text hat eben auch die journalistische Reportage einen ersten und einen letzten Satz und damit formal eine geschlossene Struktur. Der Autor einer guten Reportage sollte dementsprechend vermeiden Identifikationsgelegenheiten („Ich“) zu schaffen, sollte genau das vermeiden, was heute als Non-Plus-Ultra des Journalismus propagiert wird, den Leser in die Geschichte ziehen, so daß er geradezu süchtig nach dem nächsten Satz wird. (Was ja nur Ausdruck eines unbedingten Profitinteresses ist. Der Leser wird dadurch nicht schlauer.) Nicht zuletzt kann dieses Hineinziehen in die Geschichte dem Autor selbst zum Verhängnis werden.
Der 2015 verstorbene Journalist der NewYorkTimes, David Carr, berichtete, laut Patrick Bahners (Kursbuch 195), von dem Anchorman des amerikanischen TV-Senders NBC, Brian Williams, der so oft und so eindringlich einen US-Militäreinsatz im Irak schilderte, bei dem die Besatzung eines durch Beschuß zum Landen gezwungenen Helikopters durch den heldenhaften Einsatz eines Offiziers gerettet werden konnte, daß er bei einer von ihm moderierten Gedenkveranstaltung plötzlich selbst zu einem Mitglied der Besatzung wurde, obwohl er erst später an den Ort des Geschehens kam, als schon keine Gefahr mehr bestand. Der Schwindel flog auf; Karriere kaputt. Offensichtlich kommt es in dem Gewerbe wirklich auf lächerliche Kleinigkeiten, auf Nuancen an.